#Female Pleasure
Die Tabuisierung der weiblichen* Sexualität, die mit der Unsichtbarkeit weiblicher* Genitalien einher geht, habe ich schon vor recht langer Zeit im Zusammenhang mit Lars von Triers Nymphomaniac thematisiert. Und sie beschäftigt mich noch immer, zieht sie sich doch motivisch durch die Film- und Fernsehwelt und bildet einen Grundstein unserer rape culture, mit der ich mich ebenfalls intensiv auseinandersetze.
Insofern freue ich mich über einen Film wie #Female Pleasure, der sich eben jenem Thema widmet und die Verdrängung oder gar Kriminalisierung weiblichen* Begehrens in fünf verschiedenen Kulturen illustriert. Da ist die japanische Künstlerin Rokudenashiko, die für einen 3D-Druck ihrer Vulva verhaftet wird. Da ist die aus Somalia stammende und in London lebende Aktivistin Leyla Hussein, die gegen weibliche Genitalverstümmelung kämpft. Da ist die ehemals chassidische Jüdin Deborah Feldmann, die vor ihrer strengen Glaubensgemeinschaft in Brooklyn schließlich nach Berlin geflohen ist. Da ist die ehemalige katholische Nonne Doris Wagner, die von Vergewaltigungen im Kloster berichtet. Und da ist die indische Aktivistin Vithika Yadav, die sich gegen die rape culture und für eine gleichberechtigte Sexualität in ihrem Land engagiert.
Regisseurin Barbara Miller führt Interviews mit ihren Protagonistinnen, begleitet sie in ihrem aktivistischen Alltag und zum Teil an jene Orte, an denen sie Gewalt und Diskriminierung erfahren haben. Dabei ist die Erzählung grob in thematische Abschnitte unterteilt, beginnt mit den schmerzhaften Erfahrungen und Erinnerungen der fünf Frauen* und bewegt sich über deren individuelle Wege der Emanzipation zu einem positiv gestimmten und somit empowernden Finale.
Gemeinsam ist den fünf Geschichten, dass die Einzelschicksale niemals isoliert, sondern immer in ihrem jeweiligen kulturellen Kontext verortet sind, und dass Religion stets die Basis der strukturellen Gewalt bildet. Alle Weltreligionen sind hier vertreten: Christentum, Islam, Hinduismus, Judentum und selbst der Buddhismus. Und keine dieser Religionen kommt besser weg als die andere – allen ist eine tief verwurzelte Misogynie gemein, die in Auszügen aus religiösen Schriften deutlich wird.
An dieser Stelle ist #Female Pleasure sehr eindimensional. Der Fokus auf die Religionen erweckt den Eindruck, sich hier an einem einzigen Sündenbock abzuarbeiten. Auch eine Differenzierung fehlt größtenteils. Lediglich die Jüdin Deborah Feldman spricht von einem Widerspruch zwischen Gottglauben und Misogynie. In allen anderen Fällen scheint sich Religiosität per se mit Gleichberechtigung zu widersprechen. Die patriarchale Institution und die sie stützende Ideologie werden nicht von anderen Facetten der jeweiligen Religionen differenziert. Das ist außerordentlich schade und schwächt darüber hinaus die Argumentation des Films. Denn durch diesen Fokus wird es insgesamt sehr einfach, die geschilderten Fälle von Missbrauch und Gewalt von der eigenen Lebensrealität zu distanzieren, frei nach dem Motto: „Ich bin nicht Teil dieser rape culture, denn ich bin ja nicht religiös!“
Andererseits gehört die Einseitigkeit der Darstellungen zu einer insgesamt eher polemischen Rhetorik des Films. Harte Pauschalaussagen wie „Alle Frauen leiden“ wirken mehr als Ausdruck großer Wut, denn als glaubwürdige Gesellschaftsanalyse. Und das ist erst einmal etwas Gutes. #Female Pleasure nämlich vermittelt nicht nur Inhalte über Gewalt an Frauen*, sondern macht die Auswirkungen misogyner Strukturen auch emotional erfahrbar. Die Protagonistinnen zeigen Wut, Trauer und Enttäuschung und werden so von Stellvertreterinnen verschiedener Formen frauen*feindlicher Diskriminierung zu greifbaren Menschen und Sympathieträgerinnen.
Einzig über die titelgebende weibliche* Lust vermag uns #Female Pleasure leider wenig zu erzählen. Und das wäre auch mein größter Kritikpunkt an Barbara Millers Dokumentarfilm. Letzten Endes macht dieser nämlich die weibliche* Lust ebenso unsichtbar wie die Gesellschaft, die er kritisiert. Die Erzählungen kreisen um Negativbeispiele und Befreiungswege, nicht aber um die multiplen Formen positiv gelebter und beglückender weiblicher* Sexualität. Diese bleibt hier ein geradezu utopisches Ziel. Somit steht wieder einmal das Leid der Frauen*, nicht aber ihre Lust im Zentrum.
Damit möchte ich übrigens die Geschichten der Protagonistinnen nicht als irrelevant abtun. Im Gegenteil geben sie eindrücklich die noch immer vorherrschenden sexistischen Strukturen verschiedener Gesellschaften wider und insbesondere mit dem frustrierten Ausruf Leyla Husseins, dass sie es satt sei, die Leute immer wieder von einem völlig offensichtlichen Unrecht überzeugen zu müssen, kann ich mich sehr stark identifizieren. Diese Stimmen müssen gehört werden und sie müssen wütend statt versöhnlich sein. Sie brauchen diese Durchschlagkraft. Ganz egal, ob mir persönlich vielleicht eine etwas moderatere Haltung gegenüber den Religionen lieber gewesen wäre, so ist es doch genau diese Polemik, die #Female Pleasure letzten Endes jene Öffentlichkeit schenken kann, die es braucht, um Veränderung zu erwirken.
Es ist in dieser Hinsicht übrigens vielsagend, dass #Female Pleasure trotz der immens zurückhaltenden Darstellung oder auch nur Thematisierung positiver weiblicher Sexualität von den klassischen Vermarktungswegen der sozialen Medien ausgeschlossen ist. Der Inhalt ist schlicht und einfach nicht mit den Richtlinien von beispielsweise Facebook vereinbar. Quot erat demonstrandum: Die weibliche* Lust ist mal wieder ein Tabu, der weibliche* Körper wieder einmal der Fremdbestimmung und Kontrolle unterworfen.
Wir brauchen also diesen Film. Ob er #Female Pleasure heißen muss, ist dabei eine andere Frage. Und wer ihn sich letztlich anschaut, ebenfalls. Mögen es möglichst viele Menschen möglichst aller Geschlechter sein. Und mögen sie sich nicht vom zwiespältigen Fokus auf Religion täuschen lassen: Die katholische Kirche ist nicht der einzige Ort in Europa, an dem sexualisierte Gewalt genutzt wird, um patriarchale Machtstrukturen aufrecht zu erhalten!
Kinostart: 8. November 2018
- Was ist eigentlich feministische Filmkritik? - 22. April 2024
- Morgen ist auch noch ein Tag - 8. April 2024
- Berlinale 2024: Ivo – Kurzkritik - 26. Februar 2024






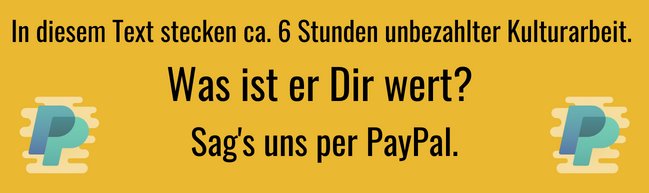
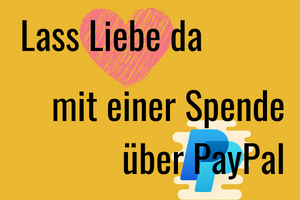
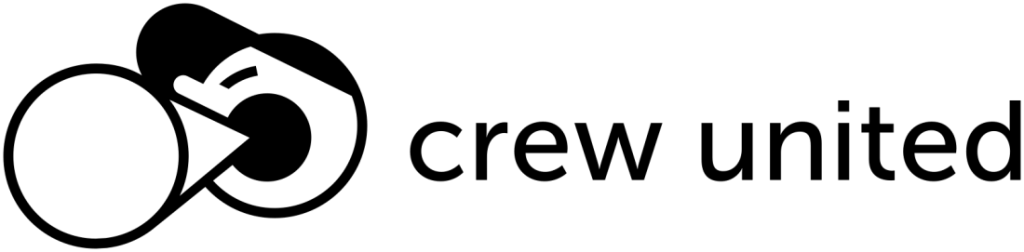
Die Religionen SIND die Wurzel des übels, da beisst die Maus kein Faden ab. Wenn richtigerweise gesagt wird „Gottglaube widerspricht der Misogynie“ dann achte man auf das Wort „Glauben“.
Glaube und Religion sind nicht das selbe!
Glaube ist der Kern, ein Zustand gleich dem Verliebtsein. Dieser ist in seinem frei von Dogmen und Diskriminierungswünschen.
Die Religion indes ist eine weltliche Verpackung. Davon werden dem Gläubigen die unterschiedlichsten angeboten, damit er seinen persönlichen Glauben darin einpacken kann.
Und diese „Verpackungsindustrie“ ist mehr an ihrem eigenen Machterhalt interessiert als am Glauben.
Das gilt es zu verstehen und endlich aufzuhören Religionen wie schützenswerte Lebenwesen zu behandeln, die man weder kritisieren noch hinterfragen darf.
„und Gott statt Religion“ – Georg Danzer
Diese Differenzierung, wie Du sie hier ausführst, finde ich sehr nachvollziehbar und sinnvoll und sie deckt sich mit meiner eigenen Einstellung. Ich finde aber nicht, dass der Film sie vornimmt. Du und ich meinen dasselbe, verwenden dafür nur unterschiedliche Begriffe. Was Du mit Religion beschreibst, würde ich institutionalisierte Religion nennen und von der Religion als solche, von einer Glaubensgemeinschaft an sich, abgrenzen. Ich glaube nämlich nicht, dass jede religiöse Gemeinschaft automatisch derart misogyn und restriktiv ist. Das deckt sich auch nicht mit meiner eigenen ganz persönlichen Erfahrung.
[…] hier noch einmal der Link zu meiner Rezension und natürlich der Trailer, die euch hoffentlich neugierig […]
[…] oder so handelt es sich um einen Film, den – wie wir in unserer Rezension damals proklamierten – alle Menschen sehen sollten. Demnach ist es nur konsequent, hier auf der FILMLÖWIN zum […]