Das fehlende Grau – Borderline ist Borderline ist Borderline ist…
Einer der Wege, die Borderline-Störung mit Hilfe einer Metapher zu erklären, ist das Fehlen des Graus. Das Leben von Borderline-Patient_innen, so die Annahme, gestalte sich ausschließlich in schwarz-weiß-Perspektiven. Graustufen, also Zwischentöne außerhalb der Entweder-Oder-Extreme, existierten in ihrer Wahrnehmung nicht. Ob dem wirklich so ist, sei einmal dahingestellt. Ich habe eine ganz eigene Einstellung zu diesem Krankheitsbild, aber dazu später mehr.
Das fehlende Grau von Nadine Heinze und Marc Dietschreit zeigt Ausschnitte aus dem Leben einer Borderline-Erkrankten, ohne ihre „psychische Störung“ als solche zu benennen. Wir sehen keine klassischen Symptome wie das Aufritzen der Haut und auch der Rückblick auf eine traumatisierende Kindheit, gerne als Erklärungs- und Ursachenmodell herangezogen, fehlt in dieser Geschichte. Stattdessen begleiten die Filmemacher_innen ihre Protagonistin durch verschiedene zwischenmenschliche Begegnungen, vorrangig mit Männern.
Die Dramaturgie wirkt zunächst verworren, lässt sich doch nur mühevoll eine Chronologie erahnen. Im Verlauf des Films jedoch wird der Sinn dieses Episoden-Mosaiks erkennbar. Jede der Begegnungen verläuft in sich chronologisch, wird nur selten durch kleine Rückblenden unterbrochen, und erzeugt Spannung hinsichtlich ihres Ausgangs. Und jede der Begegnungen verläuft ähnlich. Es gibt eine Annäherung, ein Spiel und einen Bruch. Rätselhaft bleibt recht lange das Aufeinandertreffen der jungen Heldin mit einem kleinen Mädchen, das zunächst nicht eindeutig als Kind, Schwester oder Unbekannte zu identifizieren ist.
Ebenfalls unklar ist anfänglich die Natur der erotisch aufgeladenen Bekanntschaften der namenlosen Protagonistin. Begibt sie sich bewusst in den Kontakt zu – für die Zuschauer_innen unattraktiven bzw. unsympathischen – Männern? Wie viel Kontrolle hat sie über die Situation? Ihr vollkommener Augenaufschlag, das naive Lächeln und die strategisch wohlplatzierten Schmeicheleien deuten auf einen geplanten Flirt. Aber weshalb lässt sie sich auf diese Männer ein? Kurze Szenen ihres einsamen Alltags charakterisieren sie als Opfer, das sich mit dem Schlucken von Reinigungsmitteln und Duschgel selbst Qualen zufügt. Und so stellen sich die vermeintlich selbstbewussten Annäherung schließlich als verzweifelter Versuch heraus, eine innere Leere zu füllen.
Das Spiel mit den Männern steigert sich in seiner Grausamkeit. Die Heldin ist sowohl Opfer als auch Täterin, die die Schwäche ihres Gegenübers gekonnt ausnutzt, um es zu ihren Zwecken zu manipulieren, wobei sie sich jedoch niemals ganz klar darüber zu sein scheint, um welchen Zweck es sich hierbei handelt. Verwirrend ist denn auch die Inszenierung, die durch die sanfte Musik Sympathie für eine Frau wecken will, die anderen nachhaltige emotionale Verletzungen zufügt.
Begegnungen dieser Art entstehen im System. Dies macht Das fehlende Grau sehr deutlich. Es braucht jemanden, der Macht ausübt, und jemanden, der sich dies gefallen lässt. Die Männer, die die Heldin im Laufe des Films „verführt“, machen es ihr ausgesprochen einfach, lassen sich in der Hoffnung auf ein bisschen Sex Gemeinheiten und Beleidigungen gefallen. Manchmal beschleicht uns das Gefühl, sie hätten diese Behandlung verdient.
Diese Ambivalenz, die offene Frage danach, wer hier eigentlich wen missbraucht oder misshandelt, ist die große Stärke von Das fehlende Grau. Ständig sind wir als Zuschauer_innen herausgefordert, die Situation neu zu durchdenken und zu bewerten. Was jedoch bleibt, ist das Bild einer „bösen Frau“, deren Motivation uns unbekannt ist.
Die Diagnose „Borderline“ ist ein Stigma. Die allgemeinen Assoziationen mit diesem Krankheitsbegriff sind vornehmlich negativ. Die meisten Menschen wollen nichts mit „Boderliner_innen“ zu tun haben. Die sind nämlich gefährliche emotionale Vampire, die ihr Umfeld ins Verderben stürzen und auslaugen. Wie oft habe ich (ausschließlich von Männern, übrigens) den Satz gehört: „Meine letzte Beziehung war schrecklich für mich. Meine Ex war Borderlinerin.“ Punkt. Als wäre dies alleine eine Erklärung und ein berechtigter Aufruf zu aktivem Mitleid. Aber auch eine Borderline-Störung – wenn es sie denn überhaupt gibt und sie keine moderne Form der Freud’schen „Hysterie“ darstellt – entsteht nicht im luftleeren Raum. Die Männer in Das fehlende Grau sehen über die für uns so augenscheinliche Unsicherheit und Verletzlichkeit der jungen Frau vollkommen hinweg. Es geht ihnen nur um Sex, nicht um das seelische Wohl ihres Gegenübers. Dieser Aspekt jedoch kommt in der Darstellung von Nadine Heinze und Marc Dietschreit eindeutig zu kurz.
Das fehlende Grau hilft daher meiner Meinung nach nicht, Verständnis für ein komplexes und stigmatisierendes Krankheitsbild zu wecken. Der Film hilft nicht dabei, Vorurteile abzubauen und einen liebevolleren Umgang mit betroffenen Menschen einzufordern. Die Auslassung des Krankheitsbegriffs droht darüber hinaus, promiskuitives Verhalten von Frauen zu pathologisieren. Und die finale Abgrenzung der Heldin, mit der sie die Männer vor den Kopf stößt, erscheint in diesem Kontext nicht wie ein rechtmäßiger Sinneswandel, sondern wie eine ungerechte Verletzung der armen männlichen Opfer.
Auf diese Weise kann Das fehlende Grau, trotz der in der Narration angelegten Ambivalenz, der Komplexität des Themas „Borderline“ nicht gerecht werden.
Kinostart: 25. Juni 2015
- Was ist eigentlich feministische Filmkritik? - 22. April 2024
- Morgen ist auch noch ein Tag - 8. April 2024
- Berlinale 2024: Ivo – Kurzkritik - 26. Februar 2024





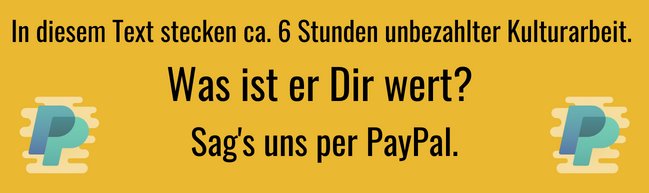
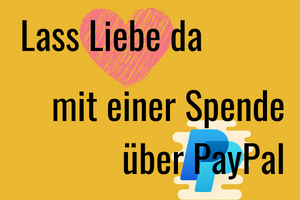
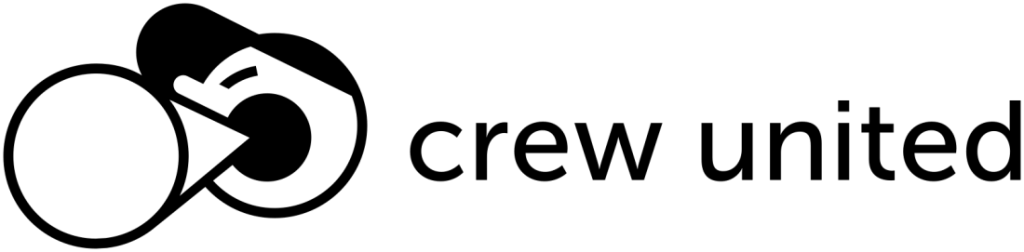
Es ist schade, dass so viel Idealismus in diese Krankheit hinein interpretiert. Es handelt sich dabei um ein international anerkanntes Krankheitsbild, viele Menschen leiden darunter. Nur weil man als Feministin nicht einsehen möchte, dass Frauen auch mal krank sein können, und diese einfach völlig unreflektiert bis aufs Blut verteidigt, ändert das nichts an dieser Tatsache. Borderline ist eine Krankheit. Auch viele Männer sind betroffen, das ist aber ein Tabu. Darüber könnte man eher mal sprechen als an falscher Stelle mit extremistischem Feminismus den eigenen Konflikt nach außen zu projizieren.
Ich verstehe nicht ganz, worauf sich Dein Kommentar bezieht, da ich mich ja dezidiert für eine Entstigmatisierung und ein besseres Verständnis für die Krankheit ausspreche, die der Film meines Erachtens nicht leistet. Und auch den Begriff Krankheit verwende ich mehrere Male. Jedoch verweise ich auch darauf, dass „Krankheit“ auch immer ein historischer Begriff ist, der sich im Laufe der Zeit ändern kann. Und insbesondere wenn es um Frauen geht, deren Verhalten von der gesellschaftlichen Norm abweicht, sind wir mit unseren Urteilen oft sehr schnell. Entscheidend ist aus meiner Sicht immer der Leidensdruck. Wer leidet, der muss geholfen werden. Aber diese Hilfe besteht eben nicht in einem Stempel, wie es der Begriff „Borderline“ (oder früher „Hysterie“) ist, sondern darin sich auf betroffene Menschen einzulassen und auch den gesellschaftlichen Kontext kritisch zu hinterfragen. Meinem Wissenstand zufolge ist Borderline keine angeborene Krankheit und hat somit eine Ursache in der Erfahrungswelt der betroffenen Person. Ich plädiere dafür, diese Erfahrungswelt zu ändern und nicht die Menschen!
Liebe Frau Rieger,
zuerst würde ich gerne auf Ihren Schlusssatz eingehen und Ihnen die Frage stellen ob Ihrer Meinung nach ein Film generell in der Lage sein kann dem Thema der Borderline-Erkrankung, gerecht zu werden und wenn wie.
So wie ich das sehe ist dies nicht möglich. Wie in Ihrer Kritik ausgeführt handelt es sich um ein sehr komplexes Störungsbild das mit vielen negativ behafteten Stereotypen verbunden ist. Den Versuch diesem in einem Film in seiner Gesamtheit gerecht zu werden, halte ich für vermessen.
Das was ein Film in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht kann, ist den zuschauenden Person Mosaiksteine nahe zu bringen. Emotionen und Dynamiken aufzuzeichnen die das Leben von betroffenen Personen charakterisieren. Das „System“ aufzuzeigen, wie Sie es so treffend formuliert haben.
Gemeinsamer Nenner der dargestellten Szenen ist das Thema Nähe- und Beziehungsfähigkeit und die Dynamiken die damit für betroffene Personen einhergehen. Diese Themen sind die zentralen Merkmale der Borderline-Erkrankung. Die Symptomatiken dieser Erkrankung können variieren und sind von den Individuen und deren psychischer Struktur abhängig. Jedoch ist das was sie alle eint, ist die Angst vor Nähe, die Unfähigkeit diese auszuhalten. Die ständige Suche nach Nähe und die anschließende Flucht und Abgrenzung von dieser wenn sie erlebt wird. Da dieser für die Krankheit grundsätzlicher Aspekt im Film sehr genau dargestellt und beleuchtet wird, finde ich ihn in dieser Hinsicht gelungen.
Auch die für das Störungsbild klassische Gratwanderung wird sehr eindrücklich dargestellt (u.a. in der Anfangsszene auf dem Dach). Wie der Name schon sagt handelt es sich bei Borderliner_innen um Grenzgänger_innen, um Personen die die Extreme suchen und sich dadurch immer wieder selbst in Gefahr bringen.
Die Protagonistin entscheidet sich trotz der Gewaltanwendungen des „Kneipen- und des Glatzenmannes“ in diesen Situationen zu verbleiben.
Beide Männer hat sie angemacht oder ihnen zumindest eindeutige Signale vermittelt und ist mit ihnen Nachhause gegangen. Beide wollen Intimität, meiner Meinung nach hat die Protagonistin auch die Bereitschaft zu dieser signalisiert (Spruch zur Nachbarin des „Kneipen-Mannes“: „Wir haben ja noch was vor“). Das grundsätzliche Unverständnis und die Irritation der Männer warum sie diese Intimität nun nicht mehr möchte, halte ich für nachvollziehbar. Aufbauend auf der Zurückweisung, überschreitet die Protagonistin anschließend Grenzen. Sie erniedrigt den „Kneipen-Mann“ wegen seines „Gestanks“ und dringt ungefragt in das räumliche Familienleben des „Glatzenmannes“ in Form des Kinderzimmers und des Ehebetts ein. Diese Grenzen wurden zwar nicht aktiv gezogen aber ich behaupte mal, dass es grenzüberschreitend ist in den Sachen der Frau und des Kindes eines verheirateten Mannes zu wühlen, wenn man gerade dessen Seitensprung ist.
Davon abgesehen ist das Thema Moralität im Zusammenhang mit dieser Störung generell und in diesem Film speziell, deplatziert. Alle beteiligten Personen (evtl. mit Ausnahme des „Waschstraßen-Mannes“) bewegen sich früher oder später in der Handlung abseits der Moralität. Die Frage welches spezielle Verhalten von welcher der beteiligten Personen nun unmoralisch oder gerechtfertigt ist, spielt für mich hier keine Rolle. Es ist die Dynamik die zählt.
Wie schon erwähnt verbleibt die Protagonistin wohlweislich der impulsiven und gewaltbereiten Anteile der beiden Männer in diesen Situationen. Sie entscheidet sich nicht zu gehen; sie entscheidet sich für die (potenziell) gefährliche Situation und kehrt sogar aktiv in diese zurück („Glatzen-Mann“ nach Rauswurf). Sie nimmt die Gefahr in Kauf. Weiter noch, sie provoziert sie, sing laut vor der Tür.
Vielleicht geht sie nicht weil sie die Eskalation und das Extreme sucht.
Vielleicht geht sie nicht weil sie nach der Abgrenzung nun wieder das drängende Bedürfnis nach Nähe empfindet (zum „Glatzen-Mann“: „Wir können ja noch Spaß haben“).
Letztlich hat sie bewusst die Eskalation der Situation provoziert. An dieser Stelle möchte ich klar sagen, dass die (versuchten) Vergewaltigung(en) als die Grausamkeiten zu benennen sind, die sie sind und die Protagonistin diese niemals gewollt hat, aber, nicht aus dem Nichts kamen und voraussehbar oder zumindest nicht auszuschließen waren.
Das Schicksal der Protagonistin hat somit einen selbstverschuldeten Anteil.
Und das ist letztlich auch das tragische an der Borderline-Erkrankung.
Betroffene Personen begeben sich immer und immer wieder in die gleichen Situationen, die gleichen Strukturen, die gleichen Muster. Lassen sich immer und immer wieder auf den gleichen „Typus“ von Partner_in ein, der/die bspw. übergriffig, emotional missbräuchlich oder generell für die betroffene Person destruktiv ist.
Das Wissen und das Bewusstsein über diese Muster und deren schädliche Konsequenzen ist betroffenen Person oft bewusst. Was das erneute Durchleben der Muster um so perfider macht.
Logischerweise müssen die Erfahrungen mit dem „Glatzen-Mann“ und dem „Kneipen-Mann“ zwangsläufig aufeinander folgen; in welcher Reihenfolge auch immer. Die Protagonistin hat also bereits am eigenen Leib erlebt welche Folgen Situationen diesen Musters haben können. Dennoch begibt sie sich besseren Wissens in diese bzw. flieht nicht rechtzeitig.
Ich habe an dieser Stelle so ausgeholt, da diese Muster das zentrale Merkmal der Erkrankung sind. Das wichtigste Merkmal von dem sich die anderen Muster und Symptome ableiten; gleich einer Baumkrone oder einer Wurzel.
Entsprechend finde ich Ihren Bewertung, dass der Film der Thematik „Borderline“ nicht gerecht wird, für unpassend. In dem Rahmen wie ein Film der Thematik überhaupt gerecht werden kann, tut er es. Genau genommen finde ich das die Herausstellung des zentralen Merkmals der Störung eine gute Strategie ist. Es ist etwas Zentrales, Übertragbares, dass bei jeder betroffenen Personen, mit welchen Ausprägungen und Symptomen auch immer, feststellbar ist.
Wie Sie bereits erwähnt haben wird im Film gekonnt mit der verschwimmenden Täter-Opfer-Rolle gespielt. Wie oberhalb beschrieben halte ich Moralität für einen sekundären Faktor der tatsächlich im Bereich des „fehlenden Graus“ liegt. Ihre Einordnungen, dass die Protagonistin als „böse Frau“ dargestellt wird und das deren finale Abgrenzung „nicht wie ein rechtmäßiger Sinneswandel, sondern wie eine ungerechte Verletzung der armen männlichen Opfer.“ wirken soll, ist für mich ehrlich gesagt zu moralisch aufgeladen und zum Erfassen des Kernthemas nicht hilfreich. Ich kenne diese Website und Ihre weitere Arbeit nicht, jedoch ist klar das Sie aus einer feministischen Perspektive schreiben.
Sicher ist die Stigmatisierung von Frauen und besonders psychisch kranken Frauen in den Medien ein wichtiges Thema das meiner Meinung nach mehr Beachtung in der Öffentlichkeit verdient, gleichwohl wirkt die Kritik, dass die Auslassung des Krankheitsbegriff zu einer Pathologisierung promiskuitiven Verhaltens von Frauen führt, konstruiert.
Inwiefern promiskuitives Verhalten von Frauen pathologischen Charakter hat, haben ausgebildete und geschulte Fachkräfte zu entscheiden.
Wer meint, sich aufgrund eines Spielfilms ein Bild über krankhaftes und charakteristisches Geschlechterverhalten machen zu können, der/die ist, meiner Meinung nach, oft sehr von sich und seiner/ihrer Meinung überzeugt und sucht und sieht oft nur die Bestätigung der vorhandenen statischen Meinungsbilder und nicht die aktive und kritische Auseinandersetzung mit diesen. Aus meiner Sicht wird den rezipierenden Personen nach kurzer Zeit klar sein, dass es sich bei der Protagonistin um eine Frau mit psychischen Problemen handelt. Für mich liegt der gedankliche Übertrag vom Verhalten dieser einen Frau, zu dem Verhalten aller Frauen, nicht nahe, daher kann ich Ihre Argumentation an diesem Punkt nicht verstehen.
Abgesehen von diesem Aspekt arbeitet der Film trotz seiner teils drastischen Darstellung viel mit Understaitment. Die rezipierenden Personen haben sich alle Informationen selbst zu suchen, haben selbst zu deuten, selbst Schlüsse zu ziehen. Um die Störung wissende Personen haben den Begriff der „emotional instabilen Persönlichkeitsstörung des Borderline Typus“ nach Lesens des Titels oder den ersten Filmminuten auf der Zunge. Mit der expliziten Nennung des Störungsbildes im Titel oder in der Handlung, wird den „unwissenden“ Personen die Möglichkeiten genommen, frei, losgelöst von Stereotypen und Dogmen zu reflektieren, zu assoziieren, zu interpretieren und eventuell im eigenen Bekanntenkreis oder sogar dem eigenen Verhalten wiederzuerkennen.
Anstatt sich einen Film über die Borderline-Erkrankung anzugucken, wird nun ein Film mit einem eigenwilligen Namen geguckt. Man macht nicht von vorneherein das „Schauerkabinett“ psychisch kranker Personen auf, sondern sieht einfach nur einen Film. Anstatt das Verhalten der beteiligten Personen sofort in einem pathologischen Kontext zu sehen, steht am Anfang das Einfühlen in ein Individuum. Das Bemühen die gezeigten Handlungen und Gefühle zu verstehen – das worauf es beim Umgang mit psychisch kranken Menschen ankommt. Daher halte ich den bewussten Verzicht des Krankheitsbegriffs für einen klugen Kunstgriff. Außerdem fände ich, dass der Film dann nicht mehr konsequent wäre in der Weise wie er Informationen präsentiert; was für mich schon wichtig ist.
In diesem Text habe ich neben meiner Meinung einige Informationen und Fakten zur Borderline-Erkrankung genannt. Grundlage dafür ist ein seit nunmehr 7 Jahren andauernder Lernprozess über diese Erkrankung. Die Informationen stammen aus Fachbüchern, Betroffenenlektüren, Therapie- und Arztgesprächen sowie aus meinem eigenen Leben. Es hat Jahre gebraucht bis ich das Störungsbild als Ganzes überhaupt erfassen und erkennen konnte. Vor diesem Hintergrund betone ich nochmal meine Aussage das ein Film von knapp 80 Minuten dem Thema nicht gerecht werden kann.
Ich komme dazu Ihnen dies zu schreiben da ich den Film vorhin gesehen habe und auf der Suche nach Interpretationen und Kritiken war. Auf dieser Seite habe ich das für mich beste Ergebnis gefunden und konnte mich nicht zurückhalten zu ein paar Gedanken Stellung zu nehmen. Auch wenn ich mich in Teilen kritisch über manche Ihrer Aussagen geäußert habe, so schätze ich Ihre Arbeit sehr und hoffe Sie können meine Kritik annehmen. Vielen Dank für Ihre Arbeit!
Besten Gruß eines Betroffenen,
Lucian